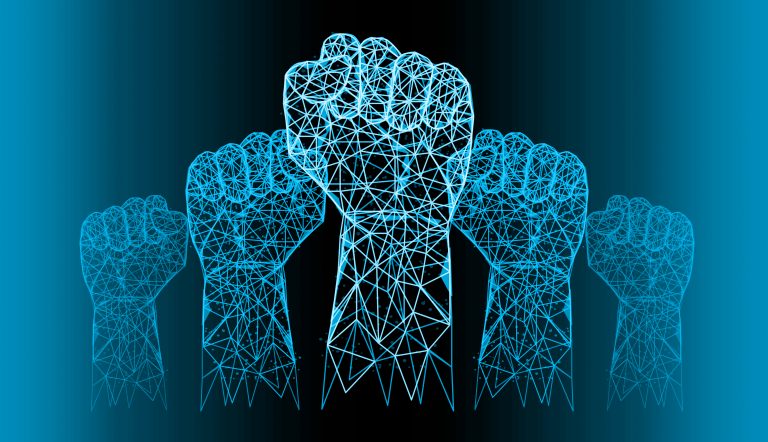Sprecht in Bildern!
Dabei ist prinzipiell gegen Expertenjargon nichts einzuwenden. Wenn Kernphysiker oder Molekularbiologen sich austauschen, kommen sie mit „Sendung mit der Maus“-Sprech nicht weit. Sie sind auf ein besonderes Vokabular angewiesen, um die Komplexität ihrer Materie wiederzugeben. Das Gleiche gilt für das Finanzwesen. Wenn sich Investmentbanker über den Markt unterhalten, greifen sie zu speziellen Begriffen, um die Dinge benennen zu können.
Problematisch wird diese Art der Kommunikation erst dann, wenn man fachfremde Menschen damit konfrontiert, zum Beispiel Privatkunden. Oft passiert dies unbewusst. Man ist unter seinen Kollegen eine bestimmte Sprache gewohnt und vergisst, außerhalb der Branche den Schalter umzulegen.
Bisweilen geschieht es aber auch mit Absicht. Durch die großzügige Verwendung von Fremdwörtern wollen manche Berater dem Privatkunden ihre Kompetenz demonstrieren. Sie müssten eigentlich aus eigener Erfahrung wissen, dass dies nicht funktionieren kann. Schon in der Schule waren jene Lehrer, die Sachverhalte schlecht erklären konnten, nicht besonders wohlgelitten. In guter Erinnerung sind hingegen Pädagogen geblieben, die selbst komplizierte Zusammenhänge anschaulich vermitteln konnten.
Wenn es ums eigene Geld geht, kommt aber noch etwas Wesentliches hinzu: Man überlässt Anlageentscheidungen und die Verwaltung seines Vermögens nicht einfach irgendjemandem. Zu groß ist die Furcht, Schiffbruch zu erleiden. Umso mehr, als die Medien gern über Bauernfänger und Hochstapler berichten. Auch die Berichterstattung über mutmaßliche Abzockerei schürt die Angst, übers Ohr gehauen zu werden.
Die Konsequenz: Für einen Privatkunden ist das Wichtigste, dass er seinem „Vermögens-Kümmerer“ ohne Wenn und Aber vertraut. Die Sprache ist dabei das entscheidende Werkzeug. Wer nicht versteht, was ein Berater mit „Blue Chips“, „Swaps“ oder „Value-ETFs“ meint, wird sich hüten, diesem sein Geld zu übertragen.
Der gängige Finanzjargon sollte daher auf seine Verständlichkeit hin abgeklopft werden. Fremdwörter dürfen dem Privatkunden nicht länger fremd vorkommen. Sie müssen erklärt werden, am besten durch konkrete Beispiele und Bilder. Denn darin liegt das Kernproblem der Anlagesprache: Sie ist zu abstrakt, zu theoretisch, zu wenig anschaulich.
Statt den Zuhörer oder Leser mit Fachbegriffen zuzumüllen, täten Banken, Vermögensverwalter und Investmentgesellschaften gut daran, die komplexe Materie auf nachvollziehbare Geschichten runterzubrechen. Davon gibt es in der Branche nämlich unendlich viele.
Und eine davon rettete mich, den damals unerfahrenen Werbetexter. Ich verzweifelte darüber, wie ich Privatkunden vermitteln sollte, dass seine Vermögensverwaltungsgesellschaft keine Zockerbude war. Da stieß ich zufällig auf einen Artikel über das „Tulpenfieber“ im 17. Jahrhundert. Und auf einmal war es ganz einfach zu erklären, was ein „risikoreiches Invest“ und eine „Spekulationsblase“ ist. Ich brauchte nur zu erzählen, wie die Preise für Tulpenzwiebeln in immer absurdere Höhen kletterten – bis sie unerwartet abstürzten.
So wurde ein komplexes Thema greifbar und erlebbar. Und die Aussage „Wir würden nicht in Tulpenzwiebeln investieren“ führte dem Privatanleger vor Augen: Jene Menschen, die sich um sein Vermögen kümmern sollten, waren vorsichtig. Sie würden mit seinem Geld so bedacht und besonnen umgehen wie mit ihrem eigenen.
Es sind solche Bilder, die sich einprägen. Aber das ist ein alter Hut. Bereits im Mittelalter, als kaum einer lesen und schreiben konnte, gelang es Menschen, auf solche Weise ihr Wissen weiterzugeben – mit dem Bild kam die Bildung. Höchste Zeit, dass Banker sich dieses genial einfache Prinzip wieder zu eigen machen!

Frank Jöricke ist Werbetexter, freier Journalist (u.a. Playboy, Neues Deutschland, Trierischer Volksfreund, Die Welt) und Autor des Romans „Mein liebestoller Onkel, mein kleinkrimineller Vetter und der Rest der Bagage“.